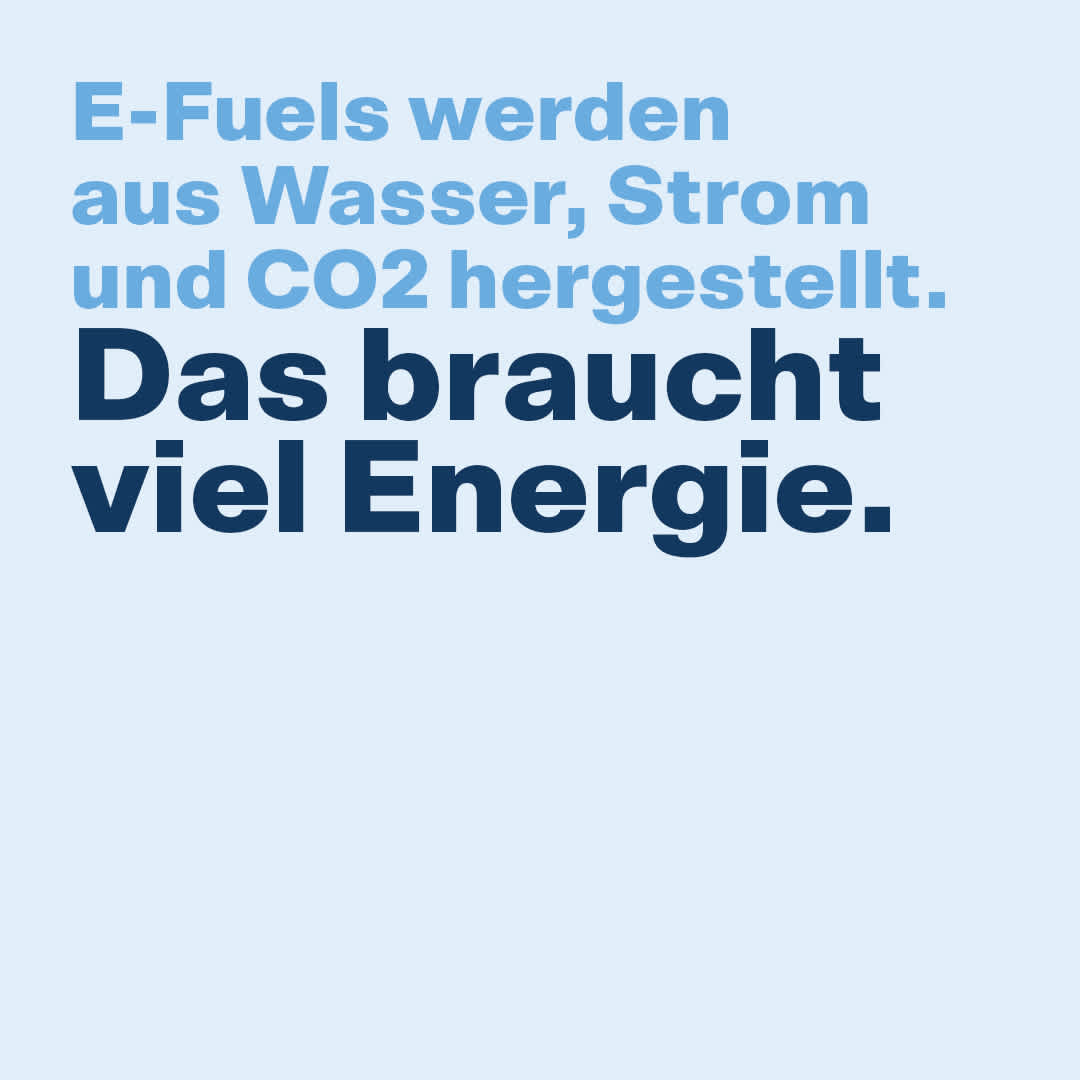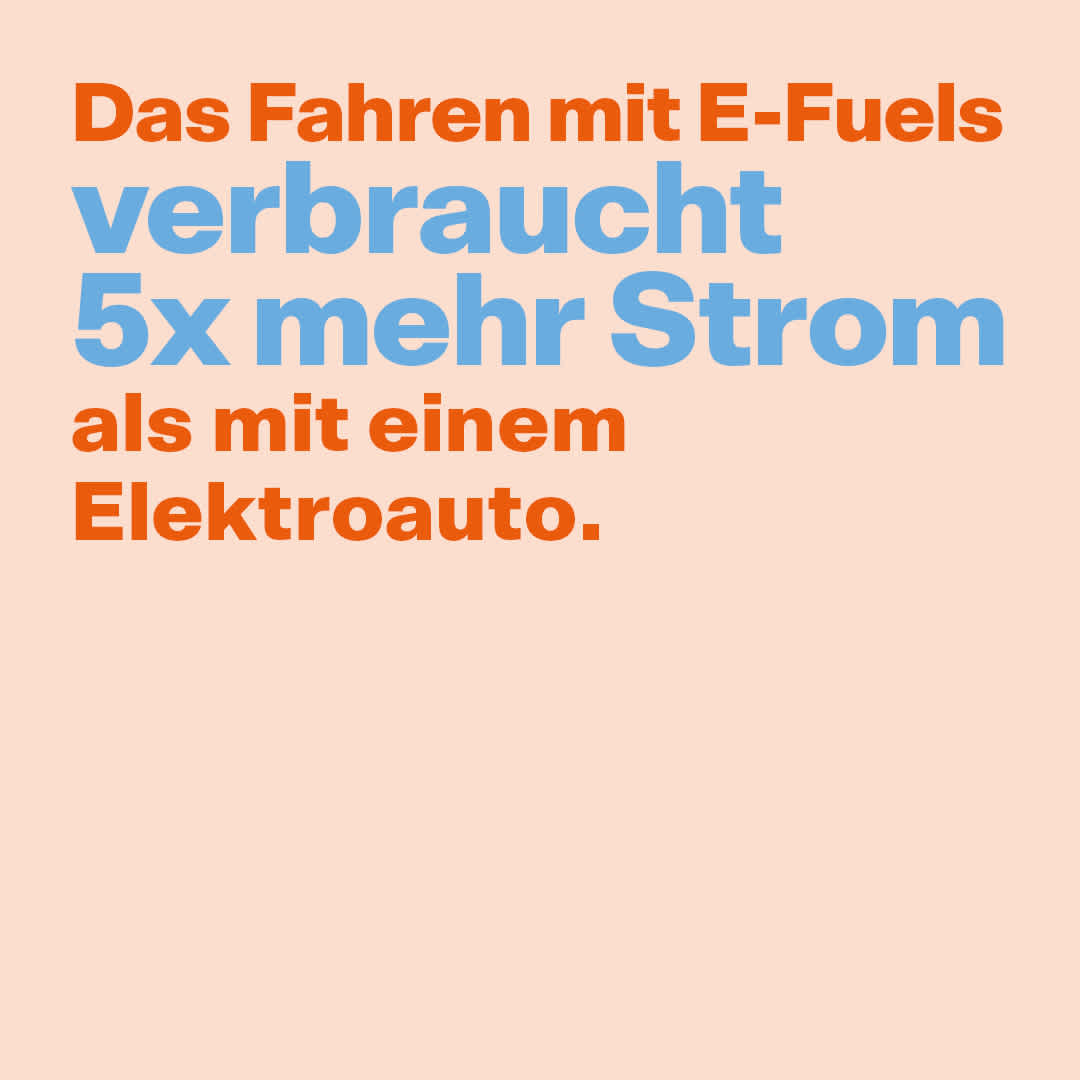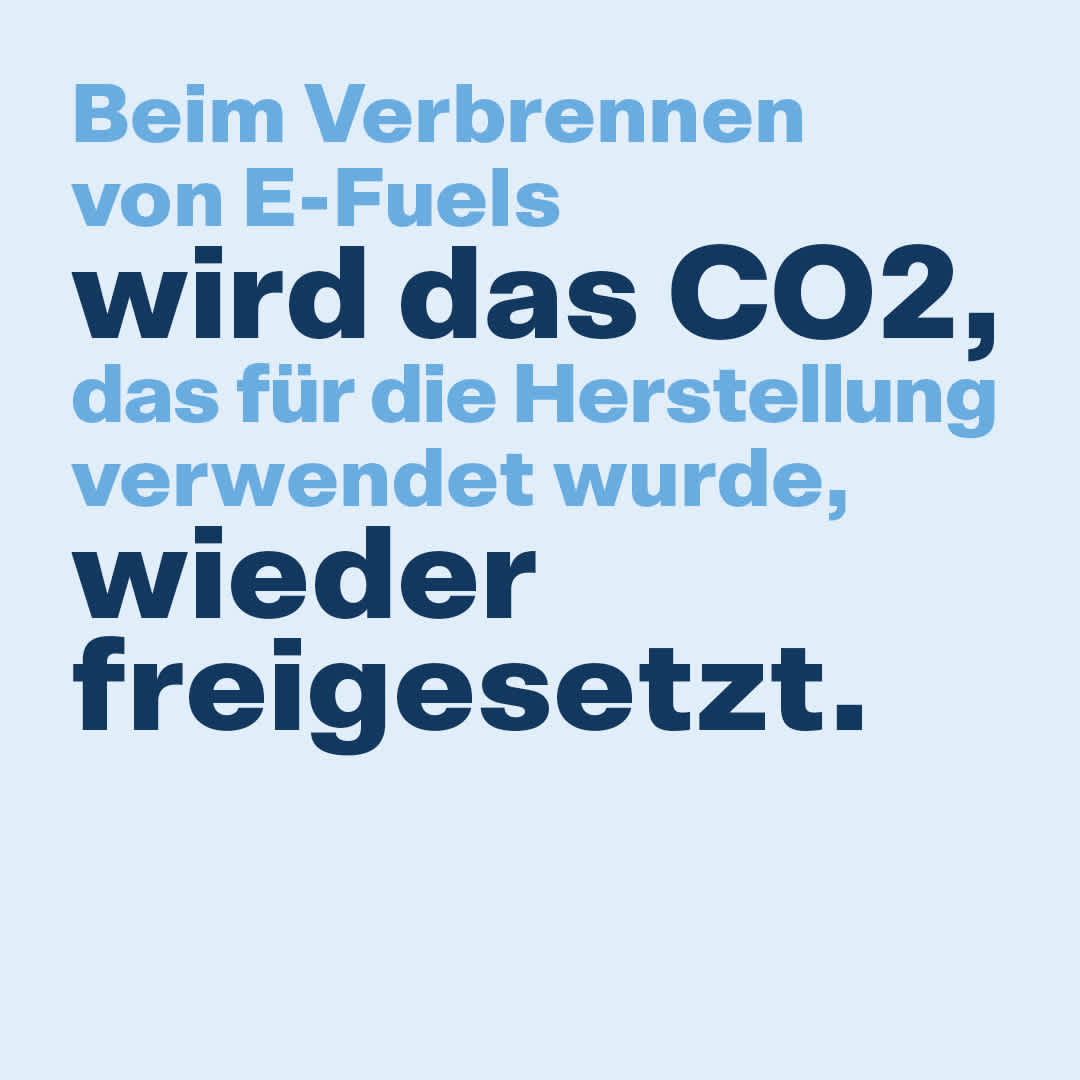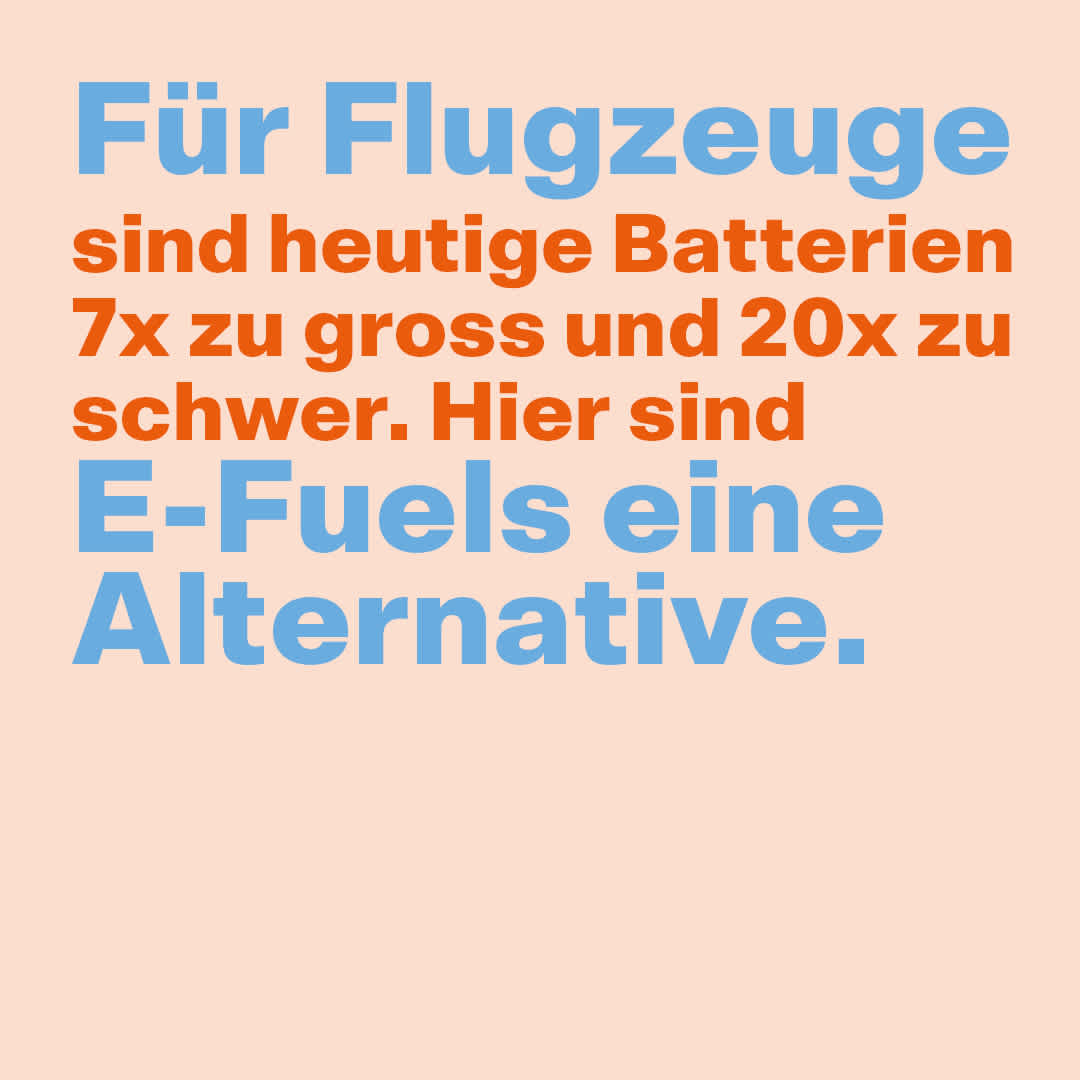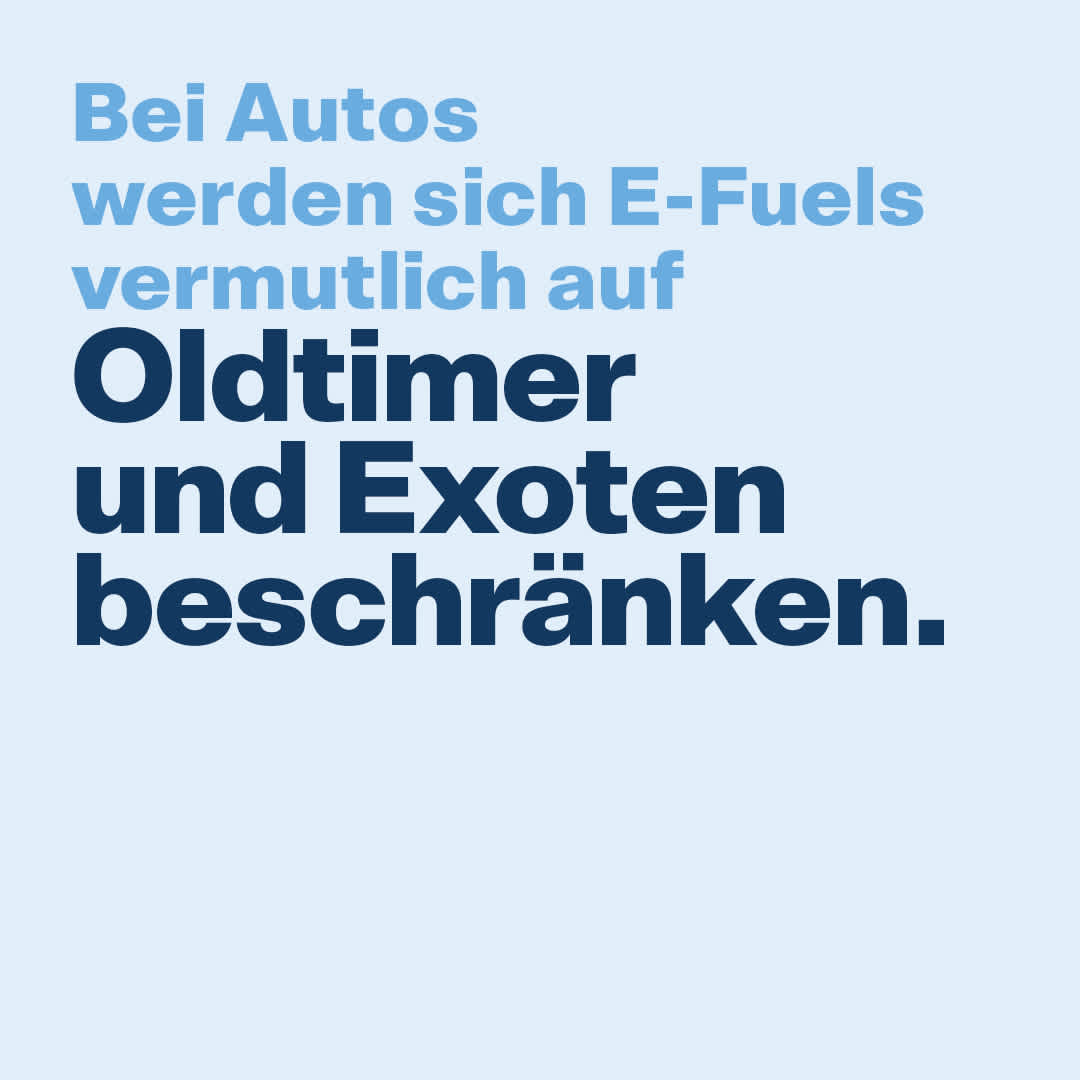Elektroautos sind völlig anders aufgebaut als Benzin- und Diesel-Autos. So fühlt sich auch das Fahren völlig anders an: dynamisch, ohne Vibrationen und Lärm. Ein störendes Aufheulen des Motors ist gar nicht möglich und das freut auch die anderen.
Elektrofahrzeuge
Ein Elektrofahrzeug ist ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug. Die zur Fortbewegung nötige elektrische Energie ist meistens in einer Lithium-Ionen-Batterie gespeichert, kann aber auch aus einer Brennstoffzelle stammen. Elektromotoren haben einen deutlich höheren Wirkungsgrad und damit geringere Energieverluste als Verbrennungsmotoren. Das maximale Drehmoment steht bereits ab der ersten Rotorumdrehung zur Verfügung. Weil der Elektromotor beim Bremsen auch als Generator arbeitet, wandelt er Bewegungsenergie wieder in elektrischen Strom um. Dieser lässt sich dann in der Batterie speichern und kann wieder für den Vortrieb genutzt werden. Dieses Prinzip wird Rekuperation genannt. Elektrofahrzeuge sind lokal emissionsfrei, CO2-Emissionen fallen jedoch in Abhängigkeit des Kraftwerktyps bei der Stromerzeugung an.
Elektrischer Komfort, nicht nur beim Fahren
Wussten Sie, dass sich manche Elektroautos bequem via App vorheizen und kühlen lassen? So steigen Sie im Winter in ein vorgewärmtes Auto und im Sommer in ein angenehm kühles. Das funktioniert auch, wenn das Elektroauto nicht am Stecker angeschlossen ist.
Hybridfahrzeuge
Hybridfahrzeuge haben mindestens zwei unterschiedliche bordeigene Antriebs- und Energiespeichersysteme. Meist ist es eine Kombination von Elektro- und Verbrennungsmotor, in der Regel ein Ottomotor. Beim Antreiben arbeitet der Elektromotor alleine oder als Unterstützung des Verbrenners. Beim Bremsen fungiert er als Generator, um der Batterie wieder Strom zuzuführen. Vollhybride ermöglichen sowohl rein elektrisches als auch kombiniertes Fahren.
Ein Steuersystem regelt effizienzabhängig, wann welcher Antrieb zum Einsatz kommt. Bei den technisch etwas einfacheren Mildhybridsystemen funktioniert der Elektromotor lediglich unterstützend. In neueren Antriebskonzepten arbeiten 48-Volt-Starter-Generatoren effizient und vergleichsweise kostengünstig auch als Booster. Sie sind entweder als riemengetriebene Nebenaggregate oder zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe direkt in den Antriebsstrang integriert. In diversen Supersportwagen dient die Hybridisierung jedoch in erster Linie der Leistungssteigerung mit nur marginalem Mehrverbrauch.
Plug-in-Hybrid
Wie normale Hybridautos verfügen auch Plug-in-Hybride über eine Kombination von Verbrennungs- und Elektromotor. Da sie aber mit leistungsfähigeren Lithium-Ionen-Batteriepaketen bestückt sind, können sie in der Regel 30 bis 80 Kilometer weit rein elektrisch fahren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hybridfahrzeuge lassen sich Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb an der Steckdose mit Strom versorgen. Die sogenannten Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) werden oft auch in grossen 4x4-SUV eingesetzt, um deren CO2-Emissionen in Grenzen zu halten.
Range Extender
Ein Range Extender ist entweder ein kleiner, zusätzlich zum Elektromotor eingebauter Verbrennungsmotor oder eine Brennstoffzelle. Der Range Extender dient jedoch nicht dem direkten Fahrzeugantrieb, sondern einzig der Stromherstellung an Bord, um die Reichweite eines Elektrofahrzeugs zu erhöhen. Der vom eigentlichen Antrieb entkoppelte Verbrennungsmotor treibt hierzu einen Generator an. Dieser wiederum versorgt den Akkumulator und somit den Elektromotor mit Strom.
Brennstoffzellenfahrzeug
Brennstoffzellenfahrzeuge sind Elektrofahrzeuge, die den Strom für den Antriebsmotor nicht aus einer Batterie, sondern aus einer Brennstoffzelle beziehen. In der Brennstoffzelle wird aus Sauerstoff und Wasserstoff elektrischer Strom erzeugt. Das Fahrzeug wird mit Wasserstoff unter einem Druck von 350 oder 700 bar betankt. Bei der Stromerzeugung in der Brennstoffzelle entsteht Wasser respektive Wasserdampf als einziges Abgas .
Brennstoffzellen-Personenwagen werden aktuell serienmässig von japanischen und koreanischen Herstellern angeboten.
Erdgasfahrzeug
Erdgasfahrzeuge werden von Ottomotoren bewegt, die mit Erdgas betrieben werden. Erdgas besteht zur Hauptsache aus Methan (CH4). Entsprechend enthält Erdgas weniger Kohlenstoffanteile (C) als Benzin oder Diesel und erzeugt bei der Verbrennung deutlich weniger CO2. Gegenüber benzinbetriebenen Ottomotoren haben Erdgasmotoren einen CO2-Vorteil von rund 20%.
Erdgasmotoren sind in modernen Personenwagen aus Gründen der Reichweite noch stets bivalent ausgelegt. Das heisst, sie werden sowohl mit Benzin als auch mit Erdgas betrieben. Aus diesem Grund benötigen die Autos je zwei Treibstoffsysteme und zwei Tanks.
Der monovalente Erdgasbetrieb könnte die Vorteile des Gases noch besser nutzen. Insbesondere die grosse Klopffestigkeit bietet Potenzial.
Erdgas, auch Compressed Natural Gas (CNG) genannt, wird an Bord des Fahrzeugs unter einem Druck von 200 bar gespeichert. Zurzeit gibt es 140 Tankstellen in der Schweiz. Erdgasmotoren wurden bereits in den 1860er-Jahren entwickelt.
Biogas-Fahrzeug
Biogas entspricht in seiner Zusammensetzung derjenigen des Erdgases. Deshalb kann Biogas von den gleichen Fahrzeugen genutzt werden. Genau wie Erdgas besteht es hauptsächlich aus Methan. Biogas wird durch die Vergärung von Biomasse hergestellt. Es wird in Biogasanlagen hergestellt, wozu Abfälle oder nachwachsende Rohstoffe vergoren werden. Eine Alternative zu Biogas stellt das synthetische Erdgas dar. Dazu wird mit Wind- und Solarstrom aus Wasser Sauerstoff und Wasserstoff hergestellt, der danach mit CO2 zu Methan, also Erdgas, umgewandelt werden kann.
Autogas
Autogas wird auch als Flüssiggas, Liquefied Petroleum Gas (LPG ), bezeichnet und wird wie Erdgas im Ottomotor eingesetzt. Flüssiggas besteht aus Propan und Butan und lässt sich unter geringem Druck verflüssigen. LPG-Fahrzeuge werden in einigen Ländern von den Autoherstellern ab Werk angeboten oder von Spezialisten nachträglich für den LPG-Betrieb umgebaut. In der Schweiz dagegen wurden mehrere Versuche zur Lancierung von LPG gestartet. Der Durchbruch gelang jedoch nicht, weil weder die Kosten- noch die Umweltvorteile wirklich gross sind.
Benzinfahrzeuge
Benzinfahrzeuge werden von einem Ottomotor angetrieben. Bei diesem Verbrennungsprinzip saugt der Kolben Luft in den Zylinder. In den aufgeladenen Motoren wird die Luft vom Turbolader oder Kompressor in die Zylinder gepresst. Der Treibstoff wird während des Ansaugvorgangs in die angesaugte Luft eingebracht und gelangt dabei entweder ins Saugrohr oder direkt in den Brennraum.
Das Luft-Treibstoff-Gemisch wird durch den Funken einer Zündkerze gezündet. Das Luft-Benzin-Verhältnis liegt über den ganzen Leistungsbereich bei rund 14,7:1 Gewichtsanteilen, was einem Lambda = 1 entspricht. Das Verdichtungsverhältnis im Ottomotor liegt bei 9:1 bis 14:1, je nach Verbrennungskonzept. Bei der Verbrennung werden Kolben und Pleuel nach unten gedrückt und versetzen die Kurbelwelle in Drehung.
Dieselfahrzeuge
Ein Dieselmotor ist wie der Ottomotor eine Verbrennungsmaschine. Sein charakteristisches Merkmal ist die Selbstzündung des eingespritzten Treibstoffes in der komprimierten Verbrennungsluft. Im Gegensatz zum Benzinmotor wird beim Dieselbrennverfahren kein Luft-Treibstoff-Gemisch, sondern ausschliesslich Luft zugeführt. Im Gegensatz zum Ottomotor ist das Luft-Treibstoff-Verhältnis im Gemisch je nach Leistungsbedarf unterschiedlich. Das Verdichtungsverhältnis im Diesel liegt bei rund 16:1 bis 17:1. Die beim Komprimieren entstehende hohe Temperatur reicht aus, um den Treibstoff zu verdampfen und das Gemisch zu zünden.
E-Fuels: Sprit, ganz ohne Erdöl
Klimafreundliches Benzin aus Strom, Wasser und Abgasen: E-Fuels klingen wie die perfekte Alternative zu Elektroautos. Doch was genau sind diese Treibstoffe, wie werden sie hergestellt und wann können wir sie an der Tankstelle kaufen?
E-Fuels, Synfuels oder Elektrokraftstoffe sind künstliche Alternativen zu fossilem Benzin oder Diesel. Wie der Name schon erraten lässt, werden sie mit Strom hergestellt statt aus dem Boden gepumpt. Je nach Anwendungszweck können diese synthetischen Kraftstoffe mit den gleichen Eigenschaften wie Benzin, Kerosin oder anderen raffinierten Erdölprodukten hergestellt werden. Die Vorteile von E-Fuels liegen somit auf der Hand: Sie können bei der Lagerung, beim Transport bis hin zur Tankstelle die bestehende Infrastruktur nutzen wie herkömmliche Treibstoffe, in die gleichen Tanks gepumpt werden und die gleichen Verbrennungsmotoren antreiben. Allerdings verursachen sie weiterhin Abgase und Lärmemissionen.
Wie werden E-Fuels hergestellt?
Normales Motorenbenzin hat je nach Gemisch mehr als 150 unterschiedliche Bestandteile, welche sich aber grösstenteils nur aus zwei Elementen zusammensetzen: Wasserstoff und Kohlenstoff. Diese Elemente lassen sich vielfältig kombinieren und bilden auch die Grundlage für synthetische Kraftstoffe. Es existieren unterschiedliche Herstellungsprozesse, sie folgen im Wesentlichen aber dem gleichen Schema.
1. Wasserstoff mit Strom herstellen
Um die erste Zutat von E-Fuels zu gewinnen, braucht es nur Wasser und viel Strom. Mittels Elektrolyse wird Wasser in einem energieintensiven Prozess in seine Bestandteile zerlegt, man erhält Wasserstoff und als Nebenprodukt Sauerstoff, der aber in der Regel nicht weiter genutzt wird.
2. Kohlenstoff aus CO2 gewinnen
Die zweite Zutat stellt eine grössere Herausforderung dar. Kohlenstoff ist zwar reichlich in der Erde vorhanden, es soll aber nicht mehr davon in die Luft freigesetzt werden, als schon vorhanden ist. Bei der Verbrennung von E-Fuels wird nämlich der enthaltene Kohlenstoff als CO2 wieder freigesetzt. Die Lösung ist die CO2-Abscheidung – ein Prozess, bei dem das CO2 aus industriellen Abgasen oder sogar direkt aus der Umgebungsluft entnommen wird. Die dafür verwendetenCCU-Anlagen (englisch für Carbon Capture and Utilization) sind gross und benötigen für das Herausfiltern des CO2 auch viel Energie.
3. Wasserstoff mit Kohlenstoff verbinden
In einem chemischer Prozess verbinden sich anschliessend Wasserstoff und CO2. Das resultierende synthetische Gaskann dann in einem mehrstufigen Prozess weiterverarbeitet und raffiniert werden, um Produkte wie E-Benzin, E-Diesel oder E-Kerosin herzustellen.

Die Zahlen und Fakten: wo machen E-Fuels Sinn?
Kraftstoffe wie E-Benzin haben vor allem einen grossen Vorteil gegenüber anderen erneuerbaren Energieträgern: Sie packen sehr viel Energie in wenig Volumen und wenig Gewicht. Betrachtet man beispielsweise die Flugindustrie, sind heutige Batterien 7-Mal zu gross und 20-Mal zu schwer, um ein Langstrecken-Passagierflugzeug elektrisch zu betreiben. Hier bieten E-Fuels eine sinnvolle Alternative zu fossilen Treibstoffen.
Was ist aber mit dem Auto?
Auch im Elektroauto sind Batterien grösser und schwerer als Benzintanks, zudem müssen Millionen Autos mit Verbrennungsmotoren auf der Strasse langfristig ersetzt werden. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, den Kraftstoff statt die Autos zu ersetzen.
Das erste Problem dabei ist die Verfügbarkeit: Es gibt heute noch fast keine E-Fuels zum Kaufen. Die grösste Pilotanlage der Welt in Chile soll ab 2026 gut 550 Millionen Liter pro Jahr produzieren können zu deutlich höheren Kosten als fossiles Benzin oder Diesel, das entspricht aber nicht einmal 10% des Treibstoffverbrauchs der Schweiz, und weniger als 1% des Verbrauchs in Deutschland.
E-Fuels verbrauchen 5x so viel Strom
Eine noch grössere Herausforderung ist der Energiebedarf von E-Fuels: Bereits in ihrer Herstellung brauchen sie doppelt so viel Energie wie sie liefern, im Verbrennungsmotor gehen davon nochmals mehr als zwei Drittel verloren. Konkret heisst das, dass ein konventionelles Auto mit E-Fuels im besten Fall rund fünf Mal so viel Strom zum Fahren braucht wie ein Elektroauto.
Die Autoindustrie ist offenbar zum gleichen Schluss gekommen: Bis im Jahr 2035 wollen Stand Juli 2022 bereits drei Viertel der Automarken in Europa nur noch Elektroautos verkaufen. Addiert man die Flottenziele von allen Autoherstellern, sollen 84% aller verkauften Neuwagen in Europa bis dahin vollelektrisch unterwegs sein. Auch die restlichen Hersteller werden einen Grossteil ihrer Neufahrzeuge als E-Autos verkaufen.
E-Fuels für Schiff- und Luftfahrt
Fazit: Wir müssen uns vom Erdöl trennen und E-Fuels werden dabei zweifellos eine wichtige Rolle spielen. Sie machen dort Sinn, wo keine bessere, effizientere Lösung existiert. Bei Personenwagen scheint das Thema schon erledigt zu sein: Bis E-Fuels in grossen Mengen erhältlich sind, will die Mehrheit der Autoindustrie aufgrund des massiv tieferen Energiebedarfs sowieso nur noch Elektroautos im Programm haben. Es bleibt offen, ob Elektrokraftstoffe im Schwerverkehr Fuss fassen können, da effizientere Antriebe unter dem Strich weniger Betriebskosten verursachen und die Treibstoffkosten im Güterverkehr einen hohen Anteil an den Betriebskosten haben. E-Fuels werden jedoch im Schiffs- und Luftverkehr unersetzlich sein, falls dieser klimafreundlich durchgeführt werden soll. Ihr Einsatz im Strassenverkehr wird sich aber wahrscheinlich auf Oldtimer und Exoten beschränken.