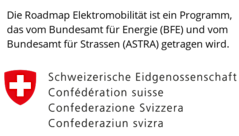Die Roadmap Elektromobilität 2030 richtet ihre Handlungsschwerpunkte an den Herausforderungen aus, die es für den Durchbruch der Elektromobilität zu bewältigen gilt. Diese erstrecken sich auf die Kategorien Personenwagen (PKW), leichte Nutzfahrzeuge (LNF), Lastwagen (LKW) und Busse im öffentlichen Verkehr (ÖV-Busse).
Die Herausforderungen sind in den drei Themenbereichen «Fahrzeuge», «Laden» und «Stromversorgung» formuliert. Sie dienen als Leitlinie, an denen sich die Mitglieder der Roadmap bei der Formulierung ihrer individuellen Massnahmen» ausrichten sollen.
Die nachfolgende Auflistung spiegelt den Stand nach der Konsultation im Juni 2025 wider. Sie soll periodisch revidiert werden, um den Stand der Entwicklung nachzubilden.
Thema "Fahrzeuge"
Beschreibung, Begründung
Die Occasionsmärkte für PKW, LNF und LKW sind eine zentrale Herausforderung. Ohne einen funktionierenden Zweitmarkt besteht eine wesentliche Hürde beim Entscheid für ein neues Elektrofahrzeug. Ausserdem fehlt damit eine wichtige Möglichkeit für einen niederschwelligen Einstieg in die Elektromobilität für preissensible Kundinnen und Kunden.
Insbesondere bei den LNF ist der zu beobachtende Wert- beziehungsweise Preiszerfall markant. Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran. Wenige Jahre nach Einlösung eines batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuges kann schon eine andere Technologie auf dem Markt sein.
Somit gilt es, diese Märkte zu verstehen, sie zu beobachten und ihre Entwicklung zu verfolgen. Ferner müssen Massnahmen getroffen werden, welche das Vertrauen der Kundschaft in elektrische Gebrauchtfahrzeuge erhöhen.
In diesem Kontext ist der Kreislauf der Batterien ein entscheidendes Element. Ein funktionierender Sekundärmarkt für gebrauchte Batterien und ein möglichst vollständiges stoffliches Recycling erhöhen die Zustimmung zur Technologie der Elektrofahrzeuge und steigert ihren Wert, insbesondere auf dem Occasionsmarkt.
Anmerkung bezüglich öV-Bussen: Der Occasionsmarkt spielt bei öV-Bussen keine Rolle, da diese Fahrzeuge nach ihrer Einsatzzeit in der Schweiz in der Regel in andere europäische Länder geliefert werden.
Lösungsansätze
Zertifikate zu den Fahrzeugen respektive zu ihren Komponenten inklusive Batterie, Formulierung von entsprechenden Mindestanforderungen (unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen wie Batteriepass und EURO 7-Regulierung)
Gestaltung von Anschlussversicherungen für Batterien oder Gewährleistungen
Durchführung von Aufklärungsmassnahmen & Kommunikation (siehe auch Herausforderung "Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung bei den Zielgruppen")
Beschreibung, Begründung
Ein wesentlicher Teil der Käuferschaft aller Fahrzeugkategorien hat Vorbehalte gegenüber der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs. Sensibilisierung, Faktenvermittlung, Informationsvermittlung sind deshalb weiterhin eine dringliche Notwendigkeit und eine Aufgabe für die Roadmap Elektromobilität, und zwar:
innerhalb der sich erweiternden Roadmap-Community
innerhalb der Branchen und den privaten und staatlichen Akteuren
für die (potentiellen) Fahrzeugkäuferinnen und -käufer
für die Öffentlichkeit
eventuell für die Fach- und allgemeinen Medien
eventuell für Influencerinnen und Influencer
Wichtige Kernbotschaften zu den Traktionsbatterien lauten: Traktionsbatterien «leben» viel länger, als man denkt. Der ökologische und soziale Fussabdruck ist bei der Produktion der Traktionsbatterien weniger ausgeprägt, als oft behauptet. Die Kreislauffähigkeit von Traktionsbatterien ist grundsätzlich gegeben und wird von der Industrie sichergestellt.
Grundsätzlich soll die Kommunikation zu Elektrofahrzeugen die Akzeptanz der Technologie fördern und das Vertrauen in eine sichere, umweltfreundliche Stromversorgung stärken. Sie soll so ausgelegt sein, dass sie nicht erwünschte Effekte verstärkt, die mit der Entwicklung der Elektromobilität einhergehen könnten, beispielsweise die Zunahme des durchschnittlichen Fahrzeuggewichts, die Verursachung von Mehrverkehr oder die Verlagerung vom öV oder Fuss-/Veloverkehr auf den motorisierten Individualverkehr.
Lösungsansätze
Erfahrungsaustausch / Vernetzungsanlässe
Probefahrten
Kommunikation
Thema "Laden"
Beschreibung, Begründung
Die fehlende Lademöglichkeit zuhause ist nach wie vor ein bedeutendes Hindernis für viele Kundinnen und Kunden, auf ein elektrisches Fahrzeug umzusteigen. Dies betrifft insbesondere Mietende und Personen im Stockwerkeigentum, die zum Laden ihres eigenen oder von der Firma zur Verfügung gestellten Fahrzeugs auf Dritte angewiesen sind. Ihre Möglichkeiten, selbst zu einer Verbesserung der Ladesituation beizutragen, sind beschränkt, da der Ausbau von den (Mit-)Eigentümerinnen und -eigentümern der Liegenschaft vorgenommen oder zumindest von ihnen zugelassen werden muss.
Eine besondere Situation stellt sich für Autofahrende ohne festen Parkplatz. Diese sind auf Lademöglichkeiten im öffentlich zugänglichen Raum angewiesen, sofern ihnen keine am Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
Lösungsansätze
Ausbau des Ladenetzes in Quartieren
Konzepte für das Laden im öffentlichen Raum (z.B. Blaue Zone)
Verstärktes Engagement grosser Immobilien-Eigentümer und Arbeitgeber
Aufbau eines Konsortiums für den Ladeinfrastrukturausbau für Immobilienbesitzer (inkl. Arbeitgeber). Dieses Konsortium könnte Energielieferanten, Netzbetreiber und weitere umfassen.
Beschreibung, Begründung
Bisher wurde beim Laden im öffentlich zugänglichen Raum vor allem das Segment der PKW betrachtet. Hier ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur in vollem Gang. Trotzdem gilt es auch hier, weiterhin das Netz zu verdichten und gut zugänglich zu machen. Die Ladestationen sollen transparente, attraktive Preise anbieten und einfach zu nutzen sein.
Zusätzlich stellt sich die Herausforderung, für den nationalen Schwerverkehr und den öffentlichen Strassenverkehr ein genügend dichtes, leistungsstarkes und gut zugängliches Netz aufzubauen. Die Ladestationen müssen reservierbar sein, um den Ladevorgang in den Logistikprozess einzubinden. Der Ausbau des LKW-Ladenetzes muss rasch vorankommen, damit die Transporteure einen zusätzlichen Anreiz erhalten, ihre Flotten zu elektrifizieren, solange sie noch von der LSVA-Befreiung profitieren und somit die Elektrofahrzeuge amortisieren können.
Angesichts des beschränkten öffentlichen Raums insbesondere in Städten und Agglomerationen und der knappen öffentlichen Mittel ist der Ausbau des Ladeangebots anspruchsvoll. Innovative Lösungen für öffentlich zugängliche Räume (z.B. in Parkhäusern, bei Freizeiteinrichtungen oder auf Firmenarealen) könnten das Angebot verbessern.
Lösungsansätze
Identifikation geeigneter Flächen (Die typischen Flächen an den Raststätten und -plätzen sind zu klein.)
Vereinfachung / Vereinheitlichung der Prozesse zur Errichtung von Ladeinfrastruktur
Verbesserung der Zusammenarbeit mit bzw. Gewinnung von Gemeinden / Kantonen
Standardisierung zwecks Sicherstellung der Interoperabilität zwischen Ladestationen verschiedener Betreiber
Schaffung von Reservierungsmöglichkeiten, gegenseitige Öffnung der eigenen Depotlademöglichkeiten für die Nutzung durch andere Logistiker
Schaffung eines LKW-Ladeparks im Mittelland als Vorzeigeprojekt
Aufbau eines Konsortiums für den Ladeinfrastrukturausbau im öffentlichen Raum. Dieses Konsortium könnte Energielieferanten, Netzbetreiber und weitere umfassen.
Beschreibung, Begründung
Das Laden an öffentlichen Ladestationen ist heute noch zu umständlich und im Vergleich zum Tanken zu kompliziert. Damit sich die Elektromobilität durchsetzen kann, muss der Strombezug mindestens so einfach sein wie das Tanken, besser noch: es soll zusätzliche Vorteile bieten. Heutige Hindernisse bei der Bedienung, beim Bezahlen und beim Preis sind zu beheben. Die Kundschaft soll transparente Informationen beziehen können, die für das Laden relevant sind, beispielsweise den Preis, die Verfügbarkeit der Ladesäule, das Steckersystem, die Leistung, die vorhandenen Services oder die Stromqualität.
Lösungsansätze
Einführung eines Qualitätsratings für Ladestationen
Einführung von allgemein akzeptierten Zahlungsmitteln (Kreditkarte, Twint) statt proprietärer Karten
Reduktion kostentreibender Elemente (z.B. Roaming)
Weitere Verbesserung der Information zu Preis, Verfügbarkeit und Leistung von Ladepunkten bereits vor dem Ladevorgang (z.B. via Ladekarten, Apps, Totems)
Thema "Stromversorgung"
Beschreibung, Begründung
Die Tarife für den Strombezug sind in der Schweiz sehr unterschiedlich, bedingt durch die Kostenstrukturen der rund 600 Energieversorgungsunternehmen sowie ihres (allerdings durch die gesetzlichen Bestimmungen eingeschränkten) Handlungsspielraums bei der Gestaltung ihrer Tarifmodelle und der Festsetzung der Preise. Besonders für gebundene Kundinnen und Kunden bestehen wenig Anreize, um den Strombezug netzschonend zu gestalten. Für gewerbliche Kunden mit hohem Leistungs- oder Energiebedarf besteht die Herausforderung darin, eine betrieblich geeignete und wirtschaftlich attraktive Versorgungslösung zu erhalten.
Lösungsansätze
Dynamische Tarife, welche das Laden in Perioden geringer Netzbelastung honorieren bzw. in Perioden hoher Netzbelastung verteuern
Flexibilität der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzbar machen, beispielsweise indem Anreize geschaffen werden, mit tiefen Leistungen über Nacht zu laden
Erstellung kundenseitiger Speichersysteme, um Tarifspitzen abzufedern
Verhandlung optimierter Tarife, welche die Betriebskostenvorteile von Elektrofahrzeugen gegenüber Verbrennern erhalten
Beschreibung, Begründung
Das Netz muss an neuralgischen Punkten verstärkt werden, damit es die in Zukunft benötigte Leistung transportieren kann. Da der Ausbau in der Regel teuer und langwierig ist, gilt es, ihn auf die relevanten Punkte zu konzentrieren und vorausschauend zu planen. Dabei sind prioritär die zukünftigen Bezugspunkte mit hoher Leistung zu identifizieren (z. B. ein Gewerbepark) und frühzeitig die entsprechenden Bewilligungsverfahren auszulösen. Eine weitere Herausforderung stellt die Sicherung der benötigten Grundstücke f�ür Netzanschlusspunkte (Trafos) dar, nebst der generellen Komplexität der Planung aufgrund der baulichen Vorgaben und der gesetzlichen Bewilligungsverfahren.
Lösungsansätze
Frühzeitige Abstimmung des Kapazitätsbedarfs zwischen Verteilnetzbetreibern und Kundinnen und Kunden, um Netzplanung darauf ausrichten zu können
Aufbau des Fachwissens zu Netzplanung und Elektromobilität bei EVU und grösseren gewerblichen Kunden
Ausgleichsmassnahmen bei nicht rentablen Standorten für Ladestationen (Finanzierungsmodell noch zu klären)
Beschreibung, Begründung
Das Energiemanagement ist das Bindeglied zwischen den Tarifen und dem Netzausbau. Mit einer geschickten Steuerung von Erzeugung und Verbrauch können Leistungsspitzen geglättet werden und der Bedarf für Netzausbauten gesenkt werden. Dabei kommt der Einbindung fluktuierender Energien (insbesondere Photovoltaik) eine wichtige Rolle zu. Das Energiemanagement ist eine Kernaufgabe der Energieversorgungsunternehmen, die zukünftig noch wichtiger wird. Als Gegenstück soll es auch nutzerseitig (Haushalte, Gewerbe) breiter umgesetzt werden.
Die Herausforderung liegt darin, das Potenzial des Energiemanagements auf breiter Ebene zu nutzen und nach den Pionierinnen und techniknahen Anwendern die allgemeine Bevölkerung, das Gewerbe und die kleinen Energieversorger dafür zu gewinnen.
Lösungsansätze
Bidirektionales Laden: Elektrofahrzeuge können als Stromspeicher und als Puffer genutzt werden. Allerdings ist heute erst eine kleine Zahl von Fahrzeugen für das bidirektionale Laden ausgerüstet.
Speicher: lokale Speicher (Elektroautos und / oder stationäre Batterien) können beitragen, die Einspeiseprofile fluktuierender Energiequellen (z. B. Photovoltaik) zu glätten
Wissensvermittlung: Flottenbetreiber, Liegenschaftsbesitzerinnen und die Bevölkerung allgemein sind über die Möglichkeiten und den Nutzen des Energiemanagements aufzuklären